| MUSIK Einführung |
aus:
Zur Unterhaltungsmusik und Musik, die sich nicht in Noten aufschreiben lässt
Die allgegenwärtige Unterhaltungsmusik heute rückt Grundschlag und gleichförmige Taktbetonung stark in den Vordergrund, damit der Konsument sich einschwingen kann in eine gleichförmige Bewegung, von der er sich passiv und selbstvergessen tragen lassen kann. Das Metrum bekommt so die Bedeutung eines kollektiven Gleichschritts, der jede Regung des individuellen Bewusstseins verdrängt und jede innere Aktivität lähmt.
In dem Bedürfnis moderner Komponisten nach Freiheit von der Bindung an das Metrum macht sich verdrängte
Individualität Luft. Indem Musik sich vom Metrum befreit, ametrisch wird, wird musikalische
Zeitordnung nur noch von der Individualität des Rhythmus bestimmt.
|
"So wie jedermann längere ereignislose Zeitabläufe mechanisch gliedert, indem er Minuten, Stunden und Tage zählt, um dem amorphen Zeitablauf
nicht schutzlos preisgegeben zu sein (alle authentischen Berichte von Gefangenen und auf einsame Inseln verschlagenen Schiffbrüchigen kreisen um dieses Problem),
artikuliert Musik die Zeit, indem sie diese durch metrisches Gleichmaß quantelt.
Musikalische Zeitstrukturierung ist zunächst
Wiederholung des immer Gleichen, so wie sich das Leben im Gleichmaß von Pulsschlag und Atem äußert. Mit dieser mechanisch gequantelten, periodisch-metrischen Zeitstruktur korrespondiert eine andere, die man Ereignis-Zeit nennen könnte. In der Musik kennen wir neben durch Metrum und Takt gegliederten Zeitabläufen auch solche, in denen das Gleichmaß aufgehoben ist und an dessen Stelle unregelmäßig - und also unvorhersehbar - eintretende Klangereignisse gesetzt werden." (Wolfgang Hufschmidt, Musik als Wiederholung, in: Wilfried Gruhn, Reflexion über Musik heute, Mainz 1981, S. 160f.) |
Zeitgenössische Kunstmusik ist zum großen Teil dadurch gekennzeichnet, dass das traditionelle Zeit-Ordnungssystem des Metrums nicht mehr gilt. Dieser Sachverhalt lässt sich erklären als Reaktion auf die metrische Übersättigung, unter der die Musik und ihre Hörer heute leiden. Metrische Strukturen sind zu Klischees geworden, die uns so vertraut sind, dass wir nicht mehr recht hinhören. Keine Kunst - auch die Musik nicht - kann sich damit zufrieden geben, dass ihre Mittel abgenutzt sind, nur noch unsere Hör- und Denkgewohnheiten bestätigen. Deshalb kann es auch in der Musik kein ein für allemal gültiges System von Regeln und kein festes Repertoire musikalischer Mittel geben.
"Die Bedeutung einer Sache ist ihr Gebrauch", sagt der Philosoph Ludwig Wittgenstein. (S. 32)
Tempo in der Musik
Metronomisches und psychologisches Zeitempfinden
Im Jahre 1816 ließ sich ein Wiener Mechaniker namens Mälzel das Metronom als seine Erfindung patentieren, ein Gerät, das der exakten Festlegung des musikalischen Tempos dient. Das menschliche Empfinden für Zeitdauer und Tempo ist bekanntlich starken Schwankungen unterworfen und von psychischen Faktoren mitbestimmt. Das Metronom ermöglicht einerseits dem Komponisten, das von ihm für die Ausführung seiner Musik gewünschte Tempo exakt anzugeben, andererseits kann es dem Ausführenden zur Kontrolle dienen, ob er das Tempo gleichmäßig ohne Temposchwankungen durchhält.
Seit der Erfindung des Metronoms ist der Streit darüber nicht abgebrochen, ob man sich bei der Ausführung von Musik so streng wie möglich an ein metronomisch messbares, gleichmäßiges Tempo halten soll oder ob ein innerhalb bestimmter Grenzen freier gehandhabtes, subjektiv als richtig empfundenes Tempo der Musik angemessener ist.
| "Da im 19. Jh. das Mittel der Tempo-Modifikation (ritardando..., accelerando ... ) so gebräuchlich war, dass z. B. Franz Liszt von leisen 'crescendi und diminuendi des Rhythmus' sprechen konnte, ist es verständlich, dass sich viele Komponisten so dezidiert gegen den Gebrauch des Metronoms aussprechen wie z. B. Carl Maria von Weber: Der Takt (Tempo) soll nicht ein tyrannisch hemmender oder treibender Mühlenhammer sein, sondern dem Musikstück das, was Pulsschlag dem Leben des Menschen ist. Es gibt kein langsames Tempo, in dem nicht Stellen vorkämen, die eine raschere Bewegung forderten, um das Gefühl des Schleppenden zu verhindern. Es gibt kein Presto, das nicht ebenso im Gegensatz den ruhigen Vortrag mancher Stellen verlangte.' Auch J. Brahms äußerte sich ähnlich ablehnend gegen den Gebrauch des Metronoms." (Das Große Lexikon der Musik, Freiburg 1976, Band 8, S. 110.) |
Andererseits hat der Schüler Chopins Karl Mikuli Einzelheiten über die
Tempoauffassung seines Lehrers berichtet, die in eklatantem Widerspruch stehen zu der verbreiteten Auffassung, dass Chopins Klaviermusik einen freieren Umgang mit dem Tempo verlange.
|
(vgl. Alexis Weißenbergs Interpretation des Nocturnes op. 62 Nr. 1): "Im Tempohalten war Chopin unerbittlich, und es wird manchen überraschen zu erfahren, dass das Metronom bei ihm nicht vom Claviere kam. Selbst bei seinem so viel verleumdeten Tempo rubato spielte immer eine, die begleitende Hand streng gemessen fort, während die andere, singende, entweder unentschlossen zögernd, oder aber wie in leidenschaftlicher Rede mit einer gewissen ungeduldigen Heftigkeit früher einfallend und bewegter, die Wahrheit des musikalischen Ausdrucks von allen rhythmischen Fesseln frei machte." |
Der Pianist Alfred Brendel unterscheidet zwischen metronomischem und psychologischem
Tempo:
|
"Meine Beziehungen zum Metronom sind eher kühler Art, und es ist mir
zuwider, wenn man die rhythmische Disziplin eines Jazzmusikers den Klassikern aufzwingt... Wenn man Beethoven nachsagte, er sei beim Klavierspielen, wenigstens in jüngeren Jahren ,meistens streng im Takt geblieben' (was ich gern glaube), so verstanden seine Zeitgenossen darunter
gewiss nicht jene metronomische Bewusstheit des Zeitverlaufs, die durch die Erfahrungen Strawinskys und der Jazzmusik hindurchgegangen ist... (Es) ... lässt sich, auf das
Festhalten des Zeitmaßes bezogen, dem metronomischen ein 'psychologisches' Tempo gegenüberstellen: der Interpret, der dem Fluss der Musik so
natürlich wie möglich folgt und ich meine hier die Natur der jeweiligen Musik und nicht die Natur des Spielers -, wird dem
'psychologischen Hörer' stets das Gefühl geben 'im Tempo zu sein'." (Alfred Brendel, Nachdenken über Musik, München 1982, S. 39f., S. 42f.) |
Das Phänomen des"swing" in der afro-amerikanischen Musik und aller von ihr beeinflussten Musik lässt sich - besser als mit dem Begriff
"Synkope" - erklären als eine subjektiv gehandhabte Tempoverschiebung, ein Vorauseilen, ein "Zu-früh-Kommen", ein Vorwegnehmen der Taktakzente der Melodie gegenüber den Zählzeiten der streng im Tempo bleibenden Begleitung.
|
"Es gehört zum swing die
Mehrschichtigkeit der Rhythmen und die Spannung zwischen ihnen - die Verlagerung rhythmischer Akzente... Diese Verlagerung nennt man in der europäischen Musik Synkope'. Aber es verrät ein grundsätzliches
Missverständnis der Jazzmäßigkeit, wenn man dieses Wort auf den Jazz anwendet. Synkopen können nur dort entstehen, wo die synkopische Verlagerung einer Note etwas Unregelmäßiges ist. Im
Jazz ist sie etwas Regelmäßiges... Besonders unbefriedigend ist es, wenn man den swing so weitgehend mit der off beat-Akzentuierung erklärt hat, dass 'off-Beat' an die Stelle von swing zu treten scheint. Off beats, - also die Akzentuierung fort vom 'beat' auf schwachen, in der europäischen Musik im allgemeinen unakzentuierten Taktteilen - schaffen nicht notwendigerweise swing; die ganze moderne Schlagermusik - auch dort, wo sie nicht swingt - ist voller 'off beats'. Einige der genauesten Gedanken über den swing hat der Schweizer Musikwissenschaftler Jan Slawe geäußert. In seinem Versuch einer Definition der 'Jazzmusik' steht im Zusammenhang mit den Begriffen 'Rhythmik und Metrik' der Satz: Der Hauptbegriff der Jazztheorie ist 'Konfliktbildung'; diese Konfliktbildungen sind ursprünglich rhythmischer Natur und bestehen im Widerstreit der gleichzeitig durchgeführten verschiedenen Gliederungen der 'musikgefüllten Zeit.' An anderer Stelle heißt es: Das allgemeine Wesen des swing ist die Rhythmus-Bezogenheit des gesamten musikalischen Geschehens... Im Besonderen postuliert der swing Regelmäßigkeit der Zeitgestaltung, um sie gleichzeitig negieren zu können. Das besondere Wesen des swing ist die rhythmische Konfliktbildung zwischen dem Fundamental- und dem Melodierhythmus; sie ist der musikalisch-technische Grundsatz des Jazz." (Joachim Ernst Berendt, Das Jazzbuch, Frankfurt am Main 1980, S. 166ff.) |
Der Musiksoziologe Theodor W. Adorno hat gerade das an jazzmäßiger Musik
kritisiert, dass ihre "Synkopen" sich
nicht - wie bei Beethoven - gegen den genormten metrischen Zeitverlauf
stellen (vgl. das Musikbeispiel S. 3 9 ff.), sondern sich ihm unterordnen und ständig anpassen:
| "Die Synkope ist nicht, wie ihr Widerpart, die Beethovensche, Ausdruck gestauter subjektiver Kraft, die gegen das Vorgesetzte sich richtete, bis sie aus sich heraus das neue Gesetz produziert. Sie ist ziellos; nirgends führt sie hin und wird durch ein undialektisches, mathematisches Aufgehen in den Zählzeiten beliebig widerrufen. Sie ist bloßes Zu-früh-Kommen... Durch den von Anfang an unverrückbar feststehenden und dem Zeitmaß nach streng durchgehaltenen, nur durch Betonung modifizierten Grundrhythmus oder genauer das Grundmetron ist sie durchaus relativiert. " (Theodor W. Adorno, Über Jazz, Moments musicaux, Frankfurt am Main 1964, S. 112.) |
Der Schlagzeuger Jo Jones sagt vom "swing":
| "Jazz muss swingen... Ein Musiker swingt nicht, wenn er beim Spielen im voraus denkt und dadurch nervös und verkrampft wird. Ich könnte ganze Kapitel über das Swingen schreiben. Da wäre zuerst einmal zu erwähnen, dass der swing ein akustisches und kein optisches Phänomen ist. Die meisten Leute lassen sich verwirren, wenn sie einem Musiker beim Spielen zusehen, und sagen dann: 'Er swingt.' Das braucht aber gar nicht der Fall zu sein... Ich habe noch nie von einem meiner Schüler im Unterricht eine vernünftige Definition des Begriffes gehört. Das beste ist immer noch, man sagt: Ob einer swingt oder nicht swingt, zeigt sich daran, ob er mit oder ohne Feeling spielt. Es ist genau dasselbe wie der Unterschied zwischen einem Händedruck, der kräftig und echt, und einem anderen, der schlapp und verlogen ist." (Shapiro/Hentoff (Hrsg.), Jazz erzählt, München 1962, S. 264) |
Dass wir beim Hören von Musik Raumvorstellungen haben, zeigt unser Sprachgebrauch: wir sprechen von hohen und tiefen, erniedrigten und erhöhten Tönen, von Tonleitern, vom Tonraum, vom Steigen und Fallen der Melodie, von der Obertonreihe, von dem Grundton und der Lage des Dreiklangs, von Ober- und Unterstimme. Vieles spricht dafür, dass unsere musikalische Raumvorstellung in Zusammenhang mit unserer Notenschrift steht.
Wie die Töne im vorgestellten Tonraum angeordnet sind, ist für unser Musik-Erleben genau so wichtig wie die Art der musikalischen Zeiterfahrung. Tonauswahl und Zusammenklänge bestimmen in hohem Maße, ob wir an einer Musik Gefallen finden oder nicht. Wir müssen uns jedoch klarmachen, dass die Maßstäbe unseres Gefallens stark von Gewohnheiten mitbestimmt sind, von Gewohnheiten, die für das Verstehen von Musik unerlässlich sind, die aber auch neue Erfahrungen erschweren können.
Unser traditionelles Dur-Moll-Tonsystem: eines unter anderen
Jede Musikkultur benutzt aus der unendlich großen Menge denkbarer Tonhöhen nur eine Auswahl. Welches Tonmaterial die traditionelle europäische Musik benutzt, kann die Klaviertastatur verdeutlichen:
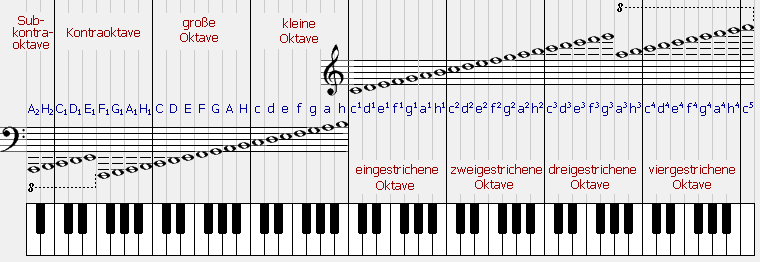
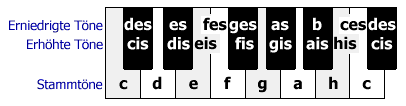 Zur Wiederholung: Die Stammtöne (weiße Tasten des Klaviers) können durch
Versetzungszeichen (# bzw. b) um einen Halbton erhöht bzw. erniedrigt werden.
Zur Wiederholung: Die Stammtöne (weiße Tasten des Klaviers) können durch
Versetzungszeichen (# bzw. b) um einen Halbton erhöht bzw. erniedrigt werden.
Der gesamte Tonraum erscheint in Oktaven unterteilt. Typisch für unser
traditionelles Dur-Moll-Tonsystem ist, dass die Oktave einerseits in 7 diatonische Stufen (5 Ganztonstufen und 2
Halbtonstufen, repräsentiert z. B. durch die weißen Tasten des Klaviers), andererseits in
12 chromatische Stufen (Halbtonstufen, repräsentiert durch die weißen und
schwarzen Tasten des Klaviers) unterteilt wird.
Den gesamten Tonvorrat eines Tonsystems nennt man auch Materialtonleiter, während man die
spezifischen Ausschnitte mit ihrer durch den Rahmen der Oktave begrenzten,
geordneten Aufeinanderfolge von Tönen als Gebrauchstonleitern oder auch einfach als
Tonleitern bezeichnet. (S. 66f)
weiter zu
Erweiterung europäischer Musik ![]()